Eigentlich besteht der Artikel, den die Welt am Sonntag am 20. November 2011 auf Seite 54 im Finanzteil veröffentlichte, aus einem Loblied auf den deutschen Riesling. Was für eine großartige Rebsorte sie sei, wie gut sie in Deutschland gedeihe, dass der Weinpapst Hugh Johnson den aus ihr gekelterten Weißwein als „den besten der Welt“ bezeichne und dass schließlich auch Günther Jauch dem Ruf dieses Weins erlegen sei und das alte Gut seiner Großtante an der Saar gekauft habe. Kurz: viel gequirlte Luft, wenig Substanz, was die Überschrift „Rendite mit Riesling“ angeht.
Preissteigerung mit Wertentwicklung verwechselt
Nach dem dritten Absatz wird die WamS konkreter. Von einer steigenden Wertenwicklung des Rieslings ist die Rede, bedingt durch die weltweite Renaissance dieses Weins. Erfreut reibt sich der Rieslingtrinker die Augen – allerdings nicht lange. Denn die Wertentwicklung, die der Autor Christian Euler meint, ist nichts als die allgemeine Preissteigerung für deutschen Wein. Euler teilt mit, dass die jeweils neuen Jahrgänge der deutschen Spitzen-Rieslinge teurer seien als die vorhergehenden: eine Binsenweisheit, die auf nahezu alle Weine der Welt zutrifft, egal ob rot oder weiß.
Vor allem: Kein Wort darüber, ob auch die alten Jahrgänge an Wert gewinnen, wenn die jungen teurer werden. Erst dann würde nämlich den Kapitalanlegern eine Rendite winken. Genau das aber ist beim Riesling nicht der Fall – sieht man von einigen wenigen Ausnahmen ab.
Für Experten nichts als kalter Kaffee
Das einzig Beispiel, das der WamS-Autor bringt, um die Wertentwicklung alter Weine zu belegen, klingt für Laien zwar atemberaubend, ist für Experten aber kalter Kaffee: Vor zwölf Jahren erzielte eine Riesling Auslese vom Kiedricher Berg aus dem Weingut Robert Weil bei einer Versteigerung bei Christie’s in London 20.000 D-Mark – der weltweit höchste Preis, der bis dahin für eine Flasche Wein aus dem 20. Jahrhundert gezahlt worden war. Tatsächlich handelte es sich bei dem Wein um eine einzelne Flasche des Jahrgangs 1921. Wer seine Rieslinge so lange horten will, um mit ihnen Geld zu verdienen, muss einen langen Atem haben. Und ein langes Leben.
Außerdem können echte Kapitalanleger rechnen. Wenn die Preise für deutsche Rieslinge zu Anfang des 20. Jahrhunderts hoch gewesen sind, kann die jährliche Rendite des Weil-Rieslings nicht sehr hoch gewesen sein. Sie muß durch die 78 Jahre geteilt werden, die der Wein im Keller gelegen hat.
Kurzfristige Renditen von 100 Prozent?
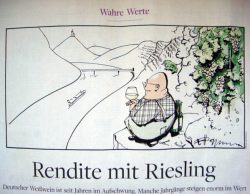 Euler ahnt wohl selbst, dass seine Rechnung nicht aufgeht. Aber er lässt nicht locker, um die Platzierung seines Artikels auf der Finanzseite der WamS zu rechtfertigen. „Wer die Top-Winzer kennt und eine gute Nase beweist, kann auch nach kurzer Wartezeit gute Gewinne erzielen“, schreibt er im Vorspann des Artikels. Der zweite große Irrtum.
Euler ahnt wohl selbst, dass seine Rechnung nicht aufgeht. Aber er lässt nicht locker, um die Platzierung seines Artikels auf der Finanzseite der WamS zu rechtfertigen. „Wer die Top-Winzer kennt und eine gute Nase beweist, kann auch nach kurzer Wartezeit gute Gewinne erzielen“, schreibt er im Vorspann des Artikels. Der zweite große Irrtum.
Als Beweis für seine Behauptung führt er die Herbstversteigerung des Verbandes Deutscher Prädikatsweingüter (VDP) an, die Ende September im Kloster Eberbach im Rheingau stattfand (weinkenner.de berichtete). Dort seien Magnumflaschen der 2010er Riesling Spätlese aus dem Rheingauer Weingut Johannishof unter den Hammer gekommen und zu einem Preis von 40 Euro pro Flasche zugeschlagen worden. Der Taxpreis lag bei 20 Euro. Also 100 Prozent Gewinn?
Mitnichten. Denn die Spätlese (genau: Rüdesheimer Berg Rottland Goldkapsel) war ein reiner Versteigerungswein. Es gab sie nur auf dieser Auktion. Niemand hat sie vorher für 20 Euro kaufen können. Der Taxpreis ist ein reiner Schätzpreis. Er wird bei VDP-Versteigerungen immer künstlich niedrig gehalten, um später optisch eindrucksvolle Preissteigerungen vorweisen zu können. „So einfach verdient man nicht 100 Prozent“, stellt Sabine Eser vom WeingutJohannishof klar.
Rendite deutscher Rieslinge meist negativ
Außerdem sind von dieser süßen Spätlese nur 13 Magnumflaschen versteigert wurden. Mehr gab und gibt es nicht von diesem Wein – ein bißchen wenig für einen Kapitalanleger. Der Traum von einer 100 Prozent-Rendite würde sich erst dann erfüllen, wenn dieser die Flaschen jetzt für 80 Euro verkaufen könnte. Schön wäre es für ihn. Doch von solchen Preisen ist der Markt weit entfernt.
Gibt es überhaupt einen Markt für deutsche Spitzen-Riesling außerhalb des regulären Weinhandels? Die WamS stellt fest: „Mittlerweile gibt es auch für Riesling etliche Versteigerungen.“ Stimmt. Genau gesagt: seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Aber bei diesen Versteigerungen handelt sich um reine VDP-Veranstaltungen wie die im Kloster Eberbach, wo kleine, besonders hochwertige Partien einmalig und exklusiv versteigert werden. Nur VDP-Weingüter können dort einliefern, keine Privatleute. Wer als Privater seinen Riesling zu Geld machen will, muss zu einer öffentlichen Weinauktion gehen.
Selbst Große Gewächse haben keinen Wiederverkaufswert
Zum Beispiel zu Koppe & Partner. Die nächste Auktion des Bremer Auktionshauses findet am 2./3. Dezember in Hamburg statt. Auch einige deutsche Weine kommen bei der Gelegenheit zum Ausruf. Zum Beispiel 6 Flaschen 2005er Riesling Großes Gewächs aus der Lage Wiltinger Gottesfuß von Reichsgraf von Kesselstatt – ein alles andere als unbekannter Name an der Mosel und ein toller Wein aus einem großen Riesling-Jahrgang. Unterer Schätzpreis für die 6 Flaschen: 90 Euro. Das entspricht 15 Euro pro Flasche. Als der Wein seinerzeit auf den Markt kam, kostete er 18,50 Euro. Ein verlustreiches Investment für den Einlieferer, sollte der Wein nicht hochgesteigert werden.
Okay, vielleicht ist der Name Reichsgraf von Kesselstatt nicht zugkräftig genug. Nehmen wir stattdessen das Große Gewächs des renommierten Pfälzer Weinguts Bassermann-Jordan aus der Lage Deidesheimer Hohenmorgen, das in Hamburg angeboten wird. Ebenfalls 6 Flaschen. Ebenfalls der Jahrgang 2005. Der Ausrufpreis ist der gleiche: 90 Euro. Sicher, auch dieser Wein könnte hochgesteigert werden. Als obere Spanne gibt Koppe & Partner 180 Euro an. Das wären 30 Euro pro Flasche – immer noch deutlich weniger als derselbe Wein im eher kleinen Jahrgang 2010 heute ab Weingut kostet (33 Euro).
Kein Sekundärmarkt für deutsche Weine
Das obere Ende der Preisspanne wird bei Weinauktionen nur sehr selten erreicht, bei deutschen Weinen fast nie. Die Aufschläge für Rieslinge sind bei öffentlichen Auktionen sehr gering. Oft werden die Weine nicht einmal zum Ausrufpreis verkauft. Die 6 Flaschen der 2002er Riesling Auslese des angesehenen Weinguts Eitelsbacher Karthäuserhof von der Mosel, die in Hamburg zum Ausruf kommen, waren schon vor zwei Monaten bei der Koppe & Partner-Auktion Berlin im Angebot. Für 72 Euro für die 6 Flaschen fand sich kein Bieter. Zu diesem unteren Schätzpreis werden sie jetzt in Hamburg wieder ausgerufen.
„Es gibt praktisch keinen Sekundärmarkt für deutsche Weine“, erklärt Gernot Koppe, Mitinhaber des Auktionshauses. Will sagen: Deutsche Weine haben keinen Wiederverkaufswert – von ganz wenigen hochkarätigen Beeren-, Trockenbeerenauslesen und Eisweinen der J.J. Prüm, Egon Müller, Robert Weil und weniger anderer mal abgesehen.
Von keiner Sachkenntnis getrübt
Was bei Bordeauxweinen funktioniert, funktioniert beim Riesling leider nicht – auch wenn die WamS das Gegenteil behauptet. Schon in der Vergangenheit war die Sonntagszeitung durch mehrere dilettantische Artikel aufgefallen, in denen den Lesern Wein als Kapitalanlage schmackhaft gemacht werden sollte. Auch der Artikel über den Riesling ist von keiner Sachkenntnis getrübt.
Autor Christian Euler ist in der Branche übrigens kein Unbekannter. Das Magazin „Focus“ hatte seinen Vertrag als Finanzredakteur vor fünf Jahren einvernehmlich aufgelöst, nachdem bekannt geworden war, dass der Journalist nebenher Herausgeber eines Börsenbriefes war und in beiden Publikationen teilweise gleichlautende Empfehlungen gab. Eine obskure Goldminenaktie sank nach seiner Empfehlung schnell von 18 Euro auf 3,58 Euro.













Kommentar hinzufügen